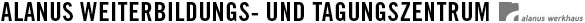Lieber Axel, so lange bist du noch nicht bei uns am Johannishof. Was reizt dich an einer Arbeit im Werkhaus?
Seit zwei Jahren ungefähr. Jo hatte mich mal vorgeschlagen. Als es mit seiner Krankheit los ging, habe ich eine Vertretung für ihn gemacht und war dann sein Backup. Es ist schon ein besonderer Ort, und das sagt mir sehr zu. Ich bin gerne Dozent für Malerei, habe Spaß daran, etwas über Malerei weiterzugeben.
Ich habe oft das Gefühl, ich kann das in meinen Kursen besser als in meinen Bildern, es kommt bei mehr Leuten an. Das Alanus Werkhaus ist tatsächlich ein Ort, wo ich das Gefühl habe und es auch erlebe, dass mit Menschen auf eine gute Art umgegangen wird. Auch eine Wertschätzung, wie ich sie Jo gegenüber erlebt habe.
Zum einen und zum anderen ist es einfach von der Lage her klasse und diese Ateliers dort sind auch irgendwie die besten, in denen ich bisher unterrichtet habe. Es sind einfach tolle Räumlichkeiten und insofern gibt es immer eine sehr schöne Atmosphäre im Kurs.
Ich bin jetzt kein ausgesprochener Anthroposoph, aber diese Wurzeln sind einfach spürbar und sehr sympathisch und sehr gut.
Wann hattest du zum ersten Mal einen Pinsel in der Hand? Also – wann hat das angefangen mit dir und der Kunst?
Ja, also schon lange. Nächstes Jahr werde ich ja 60 und ich habe dann mein vierzigjähriges Ausstellungsjubiläum. 1986 war meine erste. Mit 20, da war ich noch im Zivildienst. Zum ersten Mal den Pinsel in der Hand sicherlich schon 3 oder 4 Jahre vorher. Ich konnte immer sehr gut zeichnen, auch in der Schule. Das konnte ich schon immer gut. Aber das war letztendlich nicht der Weg für mich zur Kunst und zur Malerei, sondern es war immer dieser Blick auf Farbe. Es hat mich fasziniert, was man mit Farbe machen kann. Nur wegen meines Zeichnens hätte ich nie Kunst studiert.
Was war deine Motivation, so einen Weg als Künstler einzuschlagen?
Das hat zum einen damit zu tun, dass man sich als junger Mensch, oder ich zumindest, damals in den 80er- und 90er-Jahren, keine große Vorstellung davon gemacht habe, was es überhaupt heißt, Künstler zu sein, sein Leben lang. Was sicherlich ein anstrengender Weg ist. Das war mir relativ egal. Aber ich hatte eine enorme Motivation hin zur Farbe. Ich habe auch Musik gemacht, in Rockbands Schlagzeug gespielt und auch heute noch spiele ich Gitarre und singe in Bands. Das läuft so als meine Ausgleichsbetätigung. Ich bin schon ein musischer Mensch, aber diese Sensibilität für Farbe und auch den Klang der Farbe ist heute für mich eines meiner Hauptthemen meiner Arbeit.
Du hast einige Jahre in Peru, Lima verbracht. Was hat dich dort hingezogen?
Das war einfach eine Chance für uns. Ich habe in Kassel studiert und dort meine erste Frau kennengelernt, die Mutter meiner Tochter. Meine Frau hat damals tropische Landwirtschaft studiert und ihr Traum war, Entwicklungshilfe zu machen. Als ich mit dem Studium fertig war und sie auch, haben wir uns beworben für einen Entwicklungsdienst. Ich fand das spannend, auch mal irgendwo ganz anders hinzugehen. Man bewirbt sich dort als kleine Familie und nach verschiedenen anderen Vorschlägen hieß es plötzlich: Peru.
So sind wir da hingekommen. Wir haben in der Hauptstadt gelebt, in Lima. Ich habe mir ein Atelier gesucht und sehr schnell Kontakt bekommen. In einem ganzen Atelierhaus, voller Künstler, die auch gerade fertig waren mit dem Studium. Es war eine tolle Zeit. Plötzlich hieß es: „Mensch, die suchen Dozenten an der Hochschule. Als Deutscher, das finden die bestimmt toll.“ Und dann, zack, habe ich ein Jahr lang unterrichtet an der Nationalen Kunstakademie. Eine beeindruckende Zeit. Die hat mich sehr geprägt.
Wie hat dich die Zeit in Lima geprägt? Wie drückt sich das in deiner Kunst aus?
Man könnte jetzt direkt sagen, die Farben sind kraftvoller und bunter geworden. Das ist ein bisschen klischeehaft gedacht, aber das stimmt ein Stück weit auch. Diese Vielfalt, dieses andere, lautere, schnellere emotionalere Leben dort. Die Menschen sind einfach ein Stück anders. Zum ersten Mal in Peru habe ich gelernt, dass ich Deutscher bin. Sie haben auch immer gesagt: „Ach, du bist so deutsch.“ Und ich habe immer gedacht: „Ich bin doch nicht deutsch, ich bin voll der Nichtdeutsche irgendwie.“ Aber das sind schon so bestimmte Eigenheiten, die unsere Kultur hat, die ich später auch vermisst habe.
Was hat meine Malerei da mitgenommen und geprägt? Ich glaube, so eine Spannung zwischen einem auf der einen Seite strukturierten Suchen von dem, was ich so in mir habe, und auf der anderen Seite wirklich eine sehr emotionale farbige, freie Möglichkeit. Und das hat eine gewisse Spannung, die bis heute noch in meinen Sachen sichtbar ist, finde ich. Da finden sich Netze, Strukturen, Flächen. Versuche, konstruktivistisch ein Bild in den Griff zu kriegen. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber unheimlich farbige, emotionale Klänge, Widersprüche, kräftige Farben, viele Rot-Töne, Orange-Töne. Ich glaube, dieser Widerspruch, der prägt mein Tun seitdem. Ich bin der Deutsche, aber ich habe irgendwie noch etwas Peruanisches… Ich habe sechs Jahre dort gelebt. Da nimmt man schon was mit.
Strukturen und Linien sind ein wiederkehrendes Motiv in deinen Werken. Was bringen sie zum Ausdruck?
Ja, was bringen sie zum Ausdruck? Da fehlen mir gerade die Worte. Sie sind ein Versuch, das einzufangen, was sich so schlecht greifen lässt, was mich aber total berührt: Das Emotionale, das Klingende, die Farbe. Dem etwas entgegenzusetzen, das irgendwie zu erfassen, auf die Leinwand zu kriegen und dem eine Form zu geben, das ist sicherlich der Gedanke dahinter. Das Ganze passiert bei mir aber ohne ein gegenständliches Motiv. Ich bin auch kein ausgesprochen konzeptioneller Künstler, der ein bestimmtes Konzept verfolgt oder ein Konstruktivist, sondern ich fühle mich schon am meisten dieser gestischen Abstraktion oder dem prozesshaften Malen verpflichtet. Also so jemand wie Jackson Pollock in seinem Extrem oder auch de Kooning. Das sind die Leute, die mich schon sehr, sehr früh begeistert haben. Wo der Malprozess das Wichtige ist. Und das ist etwas, was mich immer wieder beschäftigt. Also ich fange auch bei mir an. Das Motiv ist nicht vor mir, sondern in mir. Motivation als Motiv, nenne ich das zum Beispiel.
Daraus entsteht ein Prozess. Und dieser Prozess beginnt damit, dass ich auf die Leinwand entweder Linien oder Flächen setze. Und dann fange ich an, mit diesen Flächen zu spielen. Was haben Flächen für Möglichkeiten, wenn ich da eine Fläche setze und dann kommt eine nächste. Solche Strukturen sind so etwas wie offene Flächen oder Felder. Es ist auf der einen Seite dieser zum Scheitern verurteilte, aber nie endende Versuch, mit so einem Prozess irgendwie ein Bild in den Griff zu kriegen. Und auf der anderen Seite eben dann dieses wahnsinnige Erleben von Farbe und von Klang und von berührt sein durch das, was da entsteht. Und das ist so ein Wechselspiel.
„Meine Bilder sind das, was zwischen mir und der Leinwand passiert.“ hast du mal gesagt. Was passiert zwischen dir und der Leinwand?
Das, was ich gerade angesprochen habe: Der Prozess. Zwischen mir und der Leinwand entsteht ein Prozess. Und da ich ja nicht das Abbild suche, was suche ich dann? Ich suche etwas, was zwischen mir und dem Bild entsteht. Da entsteht eine Spannung, in die ich mich reinbegebe. In einen Prozess, der dafür sorgt, dass ich irgendwie die nächste Farbe anmische. Und ich denke auch gar nicht so sehr drüber nach, welche Farbe würde jetzt in dieses Bild gut reinpassen oder das so ergänzen. Natürlich habe ich da eine gewisse Erfahrung, aber im Grunde ist es auch immer ein neues Tun, wenn so eine Farbe entsteht. Und dann ist immer die Frage: Was macht jetzt diese Farbe mit dem Bild? Also was passiert, wenn ich mit diesem neuen Element da draufgehe? Was macht diese Fläche? Wie verändert sie das? Und dann, ja, ich erlebe es als einen Spannungsraum, der zwischen mir und dem Bild ist. Ich gucke nicht nach links und rechts auf irgendwelche Motive, Stillleben, was ich jetzt umsetzen möchte oder eine Landschaft, die ich jetzt auf meine Leinwand banne, sondern ich bin da in einem Dialog zwischen Leinwand und mir.
Früher, so hast du mal in einem Interview gesagt, hat dich das fertige Bild nie interessiert. Beinahe täglich hast du dein Werk vom Vortag übermalt, hattest sogar eine Abneigung, Bilder zu vollenden. Auch deine aktuellen Arbeiten bestehen aus vielen Schichten. Was drückt sich durch die Schichten aus? Als Betrachter:in sehe ja nicht, wie viele Schichten darüber sind und trotzdem sind sie ja da.
Ich glaube schon, dass man das sehen kann, also dass man das empfinden kann, dass man das auf jeden Fall auch spüren kann an so einem Bild. Es ist ja ein Unterschied, ob ein Bild mit einer Bleistiftvorzeichnung angelegt wird und dann werden die Flächen ausgemalt oder farbig umgesetzt. Das ist auch toll in der figürlichen Malerei, aber es ist ein Unterschied.
Mich interessiert tatsächlich gar nicht so sehr das fertige Bild. Das klingt ein bisschen absurd. Gerade wenn es zu fertig ist, gibt es immer so Punkte, wo es plötzlich uninteressant wird. Ich möchte gerne, dass dieser Prozess, den ich gerade versucht habe, so ein bisschen zu beschreiben, dass das Bild einfach das Ergebnis dieses Prozesses ist. Gerade das Offene eines Bildes, vielleicht sogar das abgebrochene, das nicht ganz fertig gemachte Bild, ist manchmal für den Betrachter unheimlich spannend, weil man irgendwie sieht: „Ah, was hat er denn da versucht? Und da drunter ist ja das noch.“ So ich kann Einblicke bekommen in den Malprozess, in das, was da passiert ist.
Wenn ich mich darauf einlasse, kann ich richtig eintauchen in deine Bilder und etwas über dich und von dir erfahren?
Genau. Manchmal ist es auch zu viel. Ich höre auch oft von Leuten in meinen Ausstellungen, die sagen: „Ich bin dann noch mal gekommen und beim zweiten Mal habe ich erst so richtig verstanden.“ Oder: „Beim zweiten Mal konnte ich so richtig was damit anfangen.“
Manchmal oder oft ist es sehr viel, sehr dicht, weil ich meine Bilder auch sehr nach vorne male. Das war mir auch schon immer wichtig. Ich versuche diesen besonderen Prozess, der aus meiner Motivation mit der Leinwand in einen Dialog tritt und aus dem heraus Dinge entstehen, darzustellen, sichtbar zu machen. … Also es sind mehr Spuren als ein Bild.
Du warst befreundet mit Jo Bukowski. Wie hat dich die Zusammenarbeit mit Jo geprägt?
Sehr persönlich. Jo und ich, wir haben uns nicht als Maler kennengelernt. Wir waren beide in einem über zwei Jahre laufenden Männerseminar. Wir haben uns beide eigentlich mit uns selbst beschäftigt, unabhängig von der Farbe, und zwar eben mit dem Mannsein … Wir haben uns getroffen als zwei Maler in einem völlig anderen Kontext. Sonst wären wir, glaube ich, uns nie so nahegekommen. Gerade weil wir auch sehr ähnlich sind in der Farbigkeit. Maler sind ja nicht die besten Freunde. Das ist merkwürdigerweise immer so ein komisches Konkurrenzding. Mit Jo war das ganz anders und das war ein großes Geschenk - da mal einen Kontakt zu jemandem zu haben, dem ich mich sehr verbunden fühle, auch mit seiner Arbeit, und wir aber auf einer ganz anderen Basis miteinander da sind. Wir hatten dieses sehr vertraute Verhältnis über unsere Männergruppenarbeit, die wir da gemacht haben.
Zusammen mit Armin Burghagen setzt du mit deinen Kursen die Arbeit von Jo Bukowski fort. Was schließt an die Arbeit von Jo an, was ist der besondere Akzent, den du setzen wirst? Wie viel Jo steckt im Kurs und wie viel Axel?
Nein, ich schließe nicht an die Arbeit von Jo an. Er hatte eine ganz andere Art, daranzugehen. Ich habe mit ihm mal einen Kurs zusammen gemacht und diese Art und Weise, wie Jo das gestaltete, wie er da durch den Raum ging, auch mit seiner Präsenz, mit seiner Energie versuchte, Leute mitzunehmen und mitzureißen, das ist zum einen überhaupt nicht meine Art und ich habe die auch gar nicht. Ich arbeite ganz anders als er, also als Dozent. Ich gehe vielmehr über Sprache, über analytischeres Sehen und Verstehen von Prozessen, Verstehen, was im Bild formal funktioniert. Da sind wir sehr unterschiedlich. Insofern sehe ich mich überhaupt nicht als Fortsetzung einer Jo-Kultur-Idee.
Welche Fähigkeiten, welche Haltung vielleicht, muss oder sollte ich mitbringen, damit ich an deinem Kurs teilnehmen kann?
Ich liebe jeden Anfänger, der zum ersten Mal einen Pinsel in der Hand hat, da kann ich viel mit anfangen, aber auch mit jemandem, der schon lange Erfahrung hat. Aber es braucht doch die Bereitschaft, sich etwas zu öffnen, also einen Prozess zu öffnen und sich ein bisschen ins Gespräch zu begeben, mit mir und auch mit der Gruppe, die dabei ist. Es ist eine Gruppe, in der man da arbeitet. Es ist kein Einzelcoaching.
Offenheit ist so ein Wort?
Also Offenheit ist auf jeden Fall ein Wort. Die Lust, sich mal auf etwas einzulassen, mal etwas auszuprobieren, was sich vielleicht hinterher als nicht meins herausstellt. Sich auf einen Prozess einzulassen und auch was Neues zu wagen. Und es kann ja nichts passieren. Im Bild kann mir ja nichts passieren.
Du bist als Künstler schon lange auf einer intensiven Reise. Welche Erfahrung, welche Erkenntnis, welchen Tipp kannst du Menschen für ihr eigenes Schaffen mitgeben, die vielleicht noch nicht so lange auf dieser Reise sind? Was bedeutet für dich dieser künstlerische Prozess?
Dranbleiben an einem wirklich auch über weite Strecken schwierigen Prozess. Dieses Dranbleiben und immer wieder versuchen, sich zu reflektieren, zum Beispiel mit solchen Kursen. Das ist ja eine tolle Sache, dass es das überhaupt gibt. Dass man da in ein Gespräch gehen kann, sich selbst einfach neu zu sehen, eine neue Perspektive zu kriegen und schon ist man wieder ein Stück weiter. Man sollte irgendwie lernen, das für sich in seiner eigenen Arbeit immer wieder zu schaffen, einfach mal so richtig Abstand zu bekommen, eine neue Perspektive auf das, was man tut, und dann weitermachen zu können. Also dranbleiben, nicht anfangen sich zu wiederholen.
Das Interview mit Axel Plöger führte Katharina Bertulat.