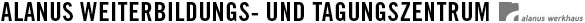Liebe Chris, "Trauern ist die Lösung", schreibst du auf deiner Website. Was meinst du damit?
Dieser Satz ist eine Reaktion darauf, dass in unserer Gesellschaft und in unserer Zeit Trauerprozesse immer als etwas Unangenehmes wahrgenommen werden.
Trauer soll vorbei sein und es wird so getan, als wären Trauerprozesse ein Problem, das man irgendwie lösen muss. Trauerprozesse sind jedoch etwas unglaublich Kostbares, das unser Körper und unsere Seele und letzten Endes auch unsere Kulturen uns zur Verfügung stellen, um das Problem der Vergänglichkeit und der Sterblichkeit allen Lebens zu lösen. Das wahrzunehmen und zu wissen, dass auch die Verstorbenen weiter zu unserem Inneren und irgendwie auch äußeren Kosmos gehören dürfen, dass wir weder vergessen noch zerbrechen müssen, sondern dass es einen mittleren Weg gibt, das finde ich großartig und das ist aus meiner Sicht überhaupt kein Problem.
Der Tod ist kein leichtes Thema. Du giltst als Pionierin der Trauerbegleitung, hast unzählige Fachartikel und Bücher geschrieben, ein Programm für Trauerbegleiter:innen oder auch das Trauerkaleidoskop entwickelt. Wie kam es, dass du dich so tief und intensiv mit Tod und Trauer beschäftigst?
Wie alle, die das richtig lange machen, komme ich durch eigene Erfahrungen dazu. Dieses Jahr werden es 40 Jahre. Also 1985, im Sommer, hat sich meine damalige Partnerin das Leben genommen. Ich war Anfang 20 und in keinster Weise vorbereitet auf so einen einschneidenden Verlust, auf ihren plötzlichen Tod. Und meine Umwelt war es auch nicht. Meine Altersgenossinnen und -genossen waren sehr überfordert damit. Und auch meine Eltern, obwohl sie sehr sozial engagiert sind.
Sie konnten alle mit so einem katastrophalen Unglücksfall in ihrer unmittelbaren Umgebung nicht gut umgehen. Das heißt, ich habe das einfach weitgehend allein erlebt und durchstehen müssen.
Eine schwierige Erfahrung. Wie hast du es trotzdem geschafft, mit dem Suizid deiner Partnerin umzugehen?
Nach ihrem Tod habe ich erstmal weitergemacht, Musik gemacht und geschrieben, Performancearbeit gemacht. Das war mein Lebenstraum. Ich wollte das nicht auch noch verlieren, nachdem ich schon jemanden verloren hatte, der mir so wichtig in der Seele war. Später habe ich im Frauenmuseum gearbeitet und eine große Ausstellung betreut. Irgendwann habe ich aber gemerkt, dass mich alles nicht mehr erfüllt. Daraufhin habe ich mit Mitte dreißig noch mal ganz von vorn angefangen, studiert, Weiterbildungen gemacht und Trauer und vor allem Trauerbegleitung zum Mittelpunkt meines beruflichen Lebens gemacht.
Was braucht ein trauernder Mensch aus deiner Erfahrung am meisten?
Erstmal es geht nicht nur um einen Moment, es geht um eine echt lange Zeit. Ich glaube, das wird oft unterschätzt, wie groß die Transformationsprozesse sind, in die jemand geworfen wird. Wenn jemand stirbt, zu dem du dich sehr stark verbunden fühlst, dann ist das ja keine eigene Entscheidung, es ist etwas, das dir und deinem Leben passiert – im Gegensatz zu allem, was du möchtest, planst und brauchst. Daran musst du dich anpassen, dich verändern, um weiterzuleben. Das dauert, weil es eigentlich alle Bereiche des Alltagslebens und der eigenen Identität betrifft.
Das heißt, es braucht sehr viel Geduld von der Umwelt. Jede und jeder Trauernde braucht Freundschaften, Familie, Nachbar:innen, Leute auf der Arbeit. Alle brauchen das. Wenn zum Beispiel 1985 und in den folgenden Jahren meine Freundinnen, meine Familie besser verstanden hätten, was mit mir los ist und nicht so ratlos gewesen wären, hätte mir das sehr geholfen. Ich habe aber sicher auch zu den etwa 20 bis 30% aller Trauernden gehört, die darüber hinaus ein oder zwei orientierende Beratungsgespräche brauchen.
Aber an der Basis, da brauchen alle Trauernden, so wie alle Menschen in einer Krise, andere, die sagen: „Ich bleibe an dir dran. Ich stelle keine Forderungen, ich sage nicht "Lass los" oder "Du wirst schon sehen". Ich bin auch nicht beleidigt, wenn du nicht mehr so fröhlich bist, sondern du bist mir ein wichtiger Mensch. Ich weiß, du bist in einer massiven Krise und ich werde die nächsten Jahre an dir dranbleiben.“
Ist deine Trauer um deine Partnerin immer noch da?
Ein bisschen Traurigkeit, ein bisschen Sehnsucht und ganz viel Verbundenheit. Was heißt das? Heute in der Trauerbegleitung, sage ich, dass Loslassen überhaupt nicht nötig ist und man sich vielmehr mit dem „verbunden bleiben“ beschäftigt. Das wusste ich vor 40 Jahren nicht. Alle haben mir vor den Kopf genagelt, ich müsste loslassen und das hinter mir lassen. Als ich dann, im Rahmen meiner Beschäftigung mit Trauer gelernt habe, dass ich das gar nicht muss, habe ich angefangen, mich sehr viel mit dieser inneren Verbundenheit mit meiner verstorbenen Freundin zu beschäftigen. Und die ist mal mehr, mal weniger stark da. Der Todestag ist im Sommer und da gibt es meist irgendwie einen Punkt, an dem ich mir wünsche, das wäre alles nicht passiert. Und an dem ich sie gern anrufen und mir ihr über die alten Zeiten reden würde. Das Tröstliche ist, dass meine Frau das kennt und mich fragt und mich hält. So ist das für mich, für uns, ein normaler Teil des Lebens geworden.
„Du musst loslassen“ hören auch andere Trauernde. Du gehst von „Continuing Bonds“ aus, den fortgesetzten Bindungen. Wieso ist dieser von Dennis Klass entwickelte Ansatz so wertvoll für Trauernde?
Das Buch ist schon 1996 erschienen, leider nie ins Deutsche übersetzt worden, aber es hat eine Art Paradigemenwechsel eingeleitet. Als Gegenpol zu dem, was damals „Breaking Bonds“ hieß. Da gab sogar Übungen, wo du Fäden durchschneiden musstest, um klarzumachen, dass du loslässt. Klass und seine Kolleginnen haben in vielen Interviewstudien nachgewiesen, dass Trauernde auf viele Arten diese Bindungen beibehalten – und dass es ihnen überhaupt nicht schadet, wie man bis dahin gedacht hatte. Im Gegenteil, Menschen mit einer stabilen inneren Verbindung zu Verstorbenen z.B. durch stärkende Erinnerungen oder geteilte Werte, kommen besser mit dem Weiterleben klar. In Deutschland wurde der Ansatz vor allem durch Roland Kachler bekannt, der in seinen Büchern viele Übungen entwickelt hat, um durch innere Bilder in Kontakt zu sein. Bis heute erlebe ich in meinen Vorträgen, wie groß die Erleichterung bei Trauernden ist, wenn das Loslassen in Frage gestellt wird und das Weiterbestehen von Bindung und Liebe quasi „erlaubt“ wird.
Wie schafft man es als Trauerende:r, die Verbindung zum/zur Verstorbenen im besten Sinne aufrecht zu erhalten?
Wenn ich Trauernde berate, frage ich immer als erstes, was die Leute schon machen. Es ist mir so wichtig, die Kompetenz der Leute einzusammeln. Dieses „In Verbindung bleiben“ ist ja nichts, was wir den Trauernden erst beibringen müssen. Sondern wir müssen sie eher ermutigen, dass das, was sie schon tun, in Ordnung ist. Sie tragen zum Beispiel Schmuck von den Verstorbenen oder eine Jacke, sie hüllen sich richtig ein. Ganz viele Leute haben zu Kerzen einen großen Bezug. Ganz viele Leute haben zeichenhafte Erlebnisse. Sie sehen bestimmte Schmetterlinge oder Vögel immer wieder. Oder Regenbögen. Und sind ganz sicher, dass das ein Zeichen der Verstorbenen ist und das ist unglaublich schön. Ich habe das selbst erlebt mit Schmetterlingen, zweimal zu sehr bedeutsamen Zeitpunkten und das waren ganz kostbare Momente. Es geht um einen entspannten Umgang mit diesen Dingen, die nicht hundertprozentig logisch oder erklärbar sind, aber die ein tiefes Wahrnehmen und Fühlen und auch Glück hervorrufen können.
Und es geht auch immer wieder um die Erlaubnis, mit den Verstorbenen zu reden. Ich sage immer, man muss den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen, nur weil jemand tot ist. Ganz viele Leute machen das bereits, aber sie schämen sich dafür. Sie gehen zum Grab und erzählen, was gerade los ist und sagen dann so etwas wie: „Jetzt gib mir doch ein Zeichen und schick mir das Rotkehlchen, damit ich weiß, dass du dafür bist.“
Wie unterstützt du die Menschen zusätzlich?
Wenn Leute sagen: das reicht mir noch nicht, dann kann man auch therapeutisch und methodisch arbeiten. Zum Beispiel mit leichten Trancen, mit Vorstellungsübungen, mit Malübungen, mit Symbolarbeit. Man kann viele unterschiedliche Methoden oder Materialien so anwenden, dass es dem Wunsch nach Verbundenheit entspricht. Manchmal hilft eine Idee wie „die Verabredung mit dem Verstorbenen“. Da nimmt man sich eine vorher bestimmte Zeit, ich sage mal eine halbe Stunde, in der man sich nur mit Erinnerungen und den eigenen Gefühlen beschäftigt. Ein Trauernder hat mir erzählt, dass er dann in ein Café geht, wo er seine verstorbene Frau kennengelernt hat. Eine trauernde Schwester ist eine Zeitlang immer früher aufgestanden, um ihrer verstorbenen Schwester einen Brief zu schreiben. Ein trauernder Vater hatte in seinem Hobbykeller die stärkste Verbundenheit gespürt, sobald er ein Werkzeug berührte, mit dem sein Sohn gearbeitet hat. Es gibt so viele Orte und Möglichkeiten. Ich frage nach, höre zu und dann bekommen wir zusammen raus, was möglich ist und was sich jetzt stimmig anfühlt. Das kann sich dann im Lauf des Trauerweges wieder ändern. Auch das ist wichtig, Verbundenheit darf mal näher, mal weiter weg sein.
Heute wird versucht, mittels KI Verstorbene für den oder die Trauernde:n lebendig zu halten. Es wird ein Avatar, ein virtueller Zwilling erstellt, mit dem ich mich als trauernder Mensch austauschen und unterhalten kann, als sei der Verstorbene noch lebendig. Übernimmt der virtuelle Zwilling den Platz des Verstorbenen?
Diese Avatare sind aktuell nur für sehr wenige Menschen zugänglich, häufiger werden bereits Chatsbots als sogenannte „Deadbots“ benutzt, die mit echten Nachrichten der Verstorbenen programmiert werden. Dann kann man über einen Messengerdienst oder eine App quasi mit den Verstorbenen kommunizieren. In Wirklichkeit wählt der programmierte Algorithmus aus den alten Nachrichten die Teile aus, die besonders tröstlich sind. Das ist ein neuer Weg, die Verbundenheit herzustellen, sozusagen ein bekanntes Bedürfnis, das mit moderner Technologie bearbeitet wird.
Unterstützt oder hemmt ein solcher virtueller Zwilling den Trauerprozess?
Ich glaube, dass das nur für die eher wenigen Menschen von Bedeutung ist, die ihre Verbundenheit nicht mit Erinnerungen, Erinnerungsgegenständen und anderem so intensiv erleben, wie sie es sich wünschen. Für diese eher kleine Gruppe von Trauernden sollten unbedingt Trauerexpert:innen bei der Programmierung des Algorithmus einbezogen werden. Sonst werden diese teuren Programme so angelegt, dass sie eine Art Suchtverhalten herstellen und nicht eine dauerhafte Zufriedenheit. Jede Abhängigkeit von anderen, sei es ein sogenanntes Medium oder ein Avatar ist kritisch zu sehen, weil da Menschen Geld machen mit dem Aufrechterhalten der Not von anderen.
Wenn ein trauernder Mensch einfach nicht zurückfindet ins Leben. Welchen Tipp kannst du ihm oder ihr geben, damit es besser geht?
Trauern ist Teil des Lebens, man lebt, während man trauert. Es ist ein Irrtum, dass man „zurückfinden muss“. Es ist aber manchmal ein sehr harter, sehr langer Teil des eigenen Lebenswegs. Dann ist es hilfreich, sich selbst die Erlaubnis zu geben, ja, das darf jetzt so sein, das darf auch immer noch so sein und das darf auch wieder so sein. Das ist oft schon ein Game-Changer: Sich nicht abzuwerten und abwertende Leute nicht mehr an sich ranzulassen. Gut ist es auch, sich auf die eigenen Ressourcen zu besinnen: Was hat mir in anderen Krisen geholfen? Bei mir ist es zum Beispiel so, dass mir Tagebuchschreiben hilft, egal was gerade in meinem Leben anstrengend ist, das hilft! Und daran muss ich mich dann erinnern. Und dranbleiben - meist fängt so am dritten Tag an, sich etwas zu verändern. Oder ganz aktuell habe ich das Meditieren wieder entdeckt!
Manchmal reicht das nicht. Was empfiehlst du dann?
Wenn ich das Gefühl habe, es gibt bestimmte Themen oder Gefühle oder Gedanken, mit denen ich mit meinem bisherigen Repertoire nicht weiterkomme, ich renne immer gegen dieselbe verschlossene Tür, ich möchte Bindung und kriege sie einfach nicht hin oder ich habe Albträume, was auch immer, dann kann man sich eine Trauerbegleiterin suchen. Trauergruppen sind auch oft hilfreich – in einem Vorgespräch wird meist geklärt, ob Gruppe oder Einzelgespräche unterstützender sind. Wenn Verluste in der Kindheit noch mal hochkommen oder sich aktuelle Verluste mit bestimmten Mangelerfahrungen in der Kindheit verbinden, dann ist eine Psychotherapie manchmal besser. Und eine Traumatherapie, wenn man neben oder gleichzeitig mit dem Trauerweg auch eine Traumafolgestörung entwickelt, z.B. weil das Auffinden einer Verstorbenen wie ein Schock war.
Seit letztem Jahr bietest du deine „Große Basisqualifikation zur Trauerbegleitung“ bei uns im Alanus Werkhaus an. An wen richtet sich die Weiterbildung?
Es ist eine berufsbegleitende Weiterbildung und sie richtet sich an Menschen, die schon irgendeine Form von psychosozialer Grundausbildung haben. Das sind natürlich alle Therapeut:innen, aber auch Krankenpfleger:innen, Bestatter:innen, Pfarrer innen, Lehrer innen oder Sozialarbeitende. Also jede:r, der oder die irgendwie im psychosozialen Bereich tätig ist und mit Trauernden in Kontakt kommt. Und wenn man ehrlich ist, jede:r, der oder die mit Menschen arbeitet, kommt mit Trauernden in Kontakt. Weil Trauern eine so menschliche Sache ist. Und sie bezieht sich ja auch nicht nur auf den Tod, sondern auf jeden Verlust.
Geht es bei deinem Angebot für Trauernde und/oder Trauerbegleiter:innen „nur“ um den Verlust durch Tod oder unterstützt du auch Menschen, die etwas anderes verloren haben? Ich denke z.B. auch an einen Verlust durch die Alzheimerkrankheit, durch einen folgenschweren Unfall z.B. mit anschließendem Wachkoma oder den Verlust des Partners durch Trennung.
Das ist mir sehr wichtig – Trauer ist die Reaktion auf einen Verlust, und Verluste begleiten unser Leben. Sie entstehen durch Trennungen oder Erkrankungen, aber auch durch z.B. Fluchterfahrungen oder den Verlust eines Arbeitsplatzes, dazu kommen der Verlust von Träumen und Lebensmöglichkeiten. In meinen Weiterbildungen sind immer Teilnehmende, die genau mit diesen Verlusterfahrungen und nachfolgenden Trauerprozessen arbeiten, das ist sehr bereichernd für alle und passt genau in meine Arbeit.
Was sind die zentralen Inhalte der Weiterbildung?
Die Überschrift ist ja: RessourcenAktivierende Trauerbegleitung. Es geht um ein an Haltung orientiertes, gleichzeitig theoriegestütztes Arbeiten mit Trauernden. Das startet mit einer Auseinandersetzung mit Trauertheorie und der Geschichte des Themas Trauer, um einen eigenen Standpunkt zu entwickeln. Die Teilnehmenden sollen lernen intuitiv und kreativ zu begleiten, aber das, was man tut, auch theoretisch begründen können. Eine menschenfreundliche, positive Grundhaltung, die Trauern eben nicht als defizitäre oder gar „krankhafte“ Lebenssituation begreift, sondern als existentiellen Transformationsprozess ist eigentlich das Wichtigste. Traumasensibles Arbeiten ist ein wichtiger Schwerpunkt für mich, weil viele Trauernde an der Psychotraumatisierung vorbei schrammen oder eine haben. Trauerbegleiter:innen müssen dafür die Anzeichen erkennen und dann weiterverweisen können. Das Stabilisieren als Start- und Endpunkt jedes Kontakts ist auch eine zentrale Grundlage der Weiterbildung. Man lernt das strukturierte Erstgespräch, verschiedene Methoden, z.B. die Arbeit mit symbolischen Gegenständen oder großen Mandala-Tüchern.
Wir beschäftigen uns damit, wie man mit Schuldfragen im Trauerprozess umgeht und mit besonderen Situationen, z.B. der Trauer nach einem Suizid. Es kommen Gastreferent:innen, die ihre Kompetenzen einbringen: Ein Bestatter kommt zum Thema Abschiednahme und Ritualgestaltung oder eine Expertin für diskriminierungssensibles Arbeiten oder eine Kollegin, die auf Kinder- und Jugendtrauerprozesse spezialisiert ist.
Daneben bietest du auch eine zweitägige Weiterbildung zum Trauerkaleidoskop an. Kurz zusammengefasst: Was ist das Trauerkaleidoskop, für wen ist es gedacht und wobei kann es helfen?
Das TrauerKaleidoskop habe ich in meiner jahrzehntelangen Arbeit und Auseinandersetzung mit Trauertheorie entwickelt. Es ist ein integratives Trauermodell und gleichzeitig ist es ein wirklich gutes und bewährtes Arbeitsmaterial. Es ermöglicht sehr schnell ein tiefes Verständnis von Trauerprozessen. Das heißt, in diesen beiden Tagen können alle Interessierten aus der systemischen Therapie, aus der Kunsttherapie, aus jeder Form von Beratung oder Sozialer Arbeit mal reinschnuppern oder auch ergänzen und abgleichen, was sie bereits für Trauernde anbieten.
Immer wieder trittst du bei deinen Vorträgen mit deiner Partnerin, der Clownin Aphrodite, auf. Was ist der Vorteil dieser Zusammenarbeit oder besser – was kann Aphrodite als Clownin, was du als Beraterin, als Mensch, nicht kannst?
Aphrodite ist eine spirituelle Clownin, die weniger über Worte als über ihre Präsenz etwas vermittelt. Das ist die wunderbare Ergänzung, da ich viele Inhalte über Geschichten und Worte transportiere und Aphrodite das mit Symbolen, ihrer Mimik und ihrer Körperlichkeit ergänzt oder vertieft. Ich habe ja auch ein Musikprogramm zum TrauerKaleidoskop, das ich sogar bei euch spielen werde, und da tritt die Musik an diese Stelle der Vermittlung, auf einen anderen, sinnlichen, intuitiven Weg.
Sehr intensiv beschäftigst du dich mit dem Thema Schuld in Trauerprozessen. In einem Interview erzählst du von einem Gespräch mit einer Frau, für die das Schuldgefühl die Verbindung zu ihrem Sohn bleibt. Ist die Funktion von Schuld also positiv zu bewerten?
Das Buch, das ich dazu geschrieben habe, heißt etwas provozierend „Schuld Macht Sinn“. Es ist eine umfangreiche Erörterung von Schuldzuweisungen, ihren Folgen und ihren Ursprüngen und da ist unter anderem eine Sinnhaftigkeit dabei. Schuldzuweisungen können Menschen etwas geben – sie kosten aber immer einen hohen Preis, deshalb würde ich nicht sagen, dass sie uneingeschränkt positiv zu sehen sind. Eher sind sie manchmal ein teurer Lösungsversuch von etwas sehr schwer Auszuhaltendem.
Vielleicht noch eine Frage: Wie kann ich als Arbeitskolleg:in, oder auch als Kamerad:in z.B. im Verein einem trauernden Menschen hilfreich begegnen und ihn oder sie unterstützen?
No-Gos sind Plattitüden wie „Das wird schon wieder“, „Du kommst schon auf die Beine“. Bei Hilfsangeboten möglichst konkret sein. Ein Satz wie „Melde dich, wenn du was brauchst“ ist sehr unkonkret. Wichtig ist normale rücksichtsvolle Mitmenschlichkeit. Das heißt, man grüßt weiter und man kann auch mal sagen „Mensch, ich habe gehört, deine Schwester ist gestorben, das tut mir sehr leid.“ Man darf auch sagen, „Ich bin fassungslos, mir fehlen die Worte.“ Ehrlichkeit ist definitiv besser als grußlos an Trauernden vorbeizugehen! Trauernde brauchen Normalität und Rücksichtnahme zugleich. Und sie brauchen viel mehr Menschen, die zuhören, als Menschen, die ihnen hilflose Rat-Schläge geben. Deshalb muss eigentlich niemand versuchen „die richtigen Worte“ zu finden. Das empathische Zuhören ist viel wichtiger!
Danke liebe Chris, für den Einblick in deine Arbeit und das inspirierende Gespräch. Vor allem das Loslassen loszulassen, finde ich großartig.
Das Interview mit Chris Paul führte Katharina Bertulat.